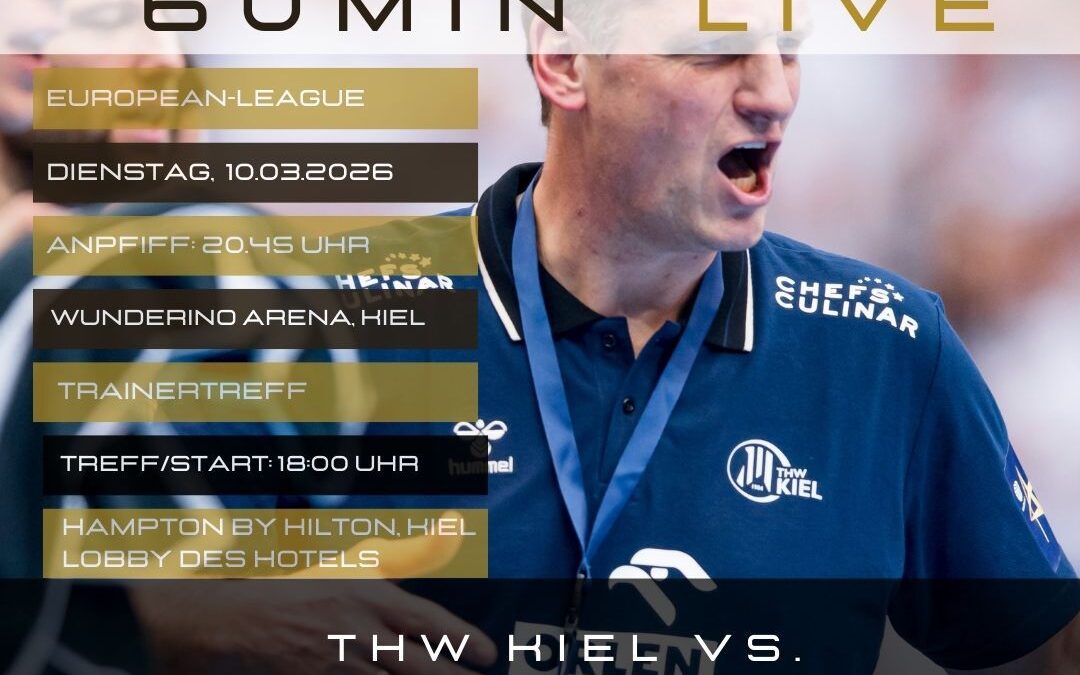„Wir sitzen am Ende des Tages alle in einem Boot.“ – Interview mit Thore Poguntke
„Wir sitzen am Ende des Tages alle in einem Boot.“ – Interview mit Thore Poguntke
11. Februar 2026| Marc Fasthoff
Thore Poguntke (38) pfiff selbst bis 2018 in der 3. Liga, wurde Schiedsrichter-Coach und ist jetzt Leiter des Schiedsrichter-Ausschusses der 3. Liga des Deutschen Handballbundes. Im Interview spricht er über den Umgang zwischen Trainern und Schiedsrichtern – und worauf es für ein gutes Miteinander ankommt.

Thore, die DHTV unterstützt seit über zehn Jahren die Fortbildungsreihe „Gemeinsam statt einsam“, bei der Trainer und Schiedsrichter gemeinsam lernen. Abseits diesen Rahmens: Wie funktioniert aus Sicht des Schiedsrichterwesens das gemeinsame Arbeiten im Alltag – sprich am Spieltag – miteinander?
Es ist eine Frage des Mindsets, wie man an die Sache herangeht. Aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, dass Schiedsrichter und Trainer am Ende des Tages im gleichen Boot sitzen; wie übrigens Zuschauer und Spieler auch. Wir wollen alle einen attraktiven Handball sehen und deswegen ist es total wichtig, ein gutes Miteinander zu gestalten. Das ist eine unserer Aufgaben als Schiedsrichter – wenngleich jeder dabei natürlich ein Stückweit auch seine Rolle wahrnehmen muss, das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Inwiefern?
Trainer wollen das Spiel gewinnen, Schiedsrichter wollen das Spiel regelgerecht über die Bühne bekommen. Diese unterschiedlichen Interessen sind Fakt und deswegen ist es total wichtig, sich bewusst zu sein, in welcher Rolle man steckt. Kritik ist in der Regel in keine Richtung persönlich, sondern hat mit der Rolle zu tun. Ich finde es außerdem total wichtig, zu verstehen, warum der andere so reagiert wie er reagiert.
Wie gelingt das aus deiner Sicht?
Das Reflektieren von Leistung hat einen großen Anteil. Ebenso, wie sich Trainer und auch Schiedsrichter auf ein Spiel, vorbereiten, sollte es nach dem Spiel dazugehören, sich zu reflektieren. Als Schiedsrichter kann man die Trainer dafür auch mal in die Kabine holen und um Feedback bitten. Das bedeutet manchmal sicherlich, dass man auch harte Kritik bekommt, aber das Entscheidende ist das Gespräch. Es ist okay, nicht einer Meinung zu sein, aber vorher noch einmal einen intensiven Blick auf das Spiel und die Leistung zu werfen, schadet nicht, denn vielleicht hat man doch etwas nicht gesehen. Ich bin daher ein großer Freund davon, einen Austausch mit den Trainern zu schaffen, das ist wertvoll – ob nach dem Spiel oder vielleicht auch mit etwas Abstand. Wir hatten zu unserem Sommerlehrgang der 3. Liga beispielsweise Jari Lemke eingeladen.
Was versteht man aus Schiedsrichter-Sicht unter einem guten Miteinander, das du eben ja schon beiläufig erwähnt hast? Eure Perspektive als Schiedsrichter mag sich ja durchaus unterscheiden zur Auffassung der Trainer von einem guten Miteinander.
Da wir unterschiedliche Interessen haben, ist das sicherlich so. Zum guten Miteinander gehört, dass ich als Schiedsrichter weiß, wer als Trainer mein Ansprechpartner ist. Es darf auch dazugehören, dass man einen kurzen Smalltalk führt, aber mit einem ausgewogenen Verhältnis zu beiden Seiten. Es sieht schlecht aus, wenn man mit einem Trainer 30 Sekunden und mit dem anderen 30 Minuten spricht. Den ersten Eindruck hat man kein zweites Mal. Und wenn man weiß, dass der Trainer gerade zur Diskussion steht, sollte man nicht fragen, wie es läuft (schmunzelt).
Und ein gutes Miteinander während des Spiels?
Im Spiel geht es in erster Linie darum, dafür zu sorgen, seine Aufgabe wahrzunehmen – und wenn Grenzen überschritten werden, das Spiel zurück in die erlaubten Bahnen zu lenken. Es ist geschickt als Schiedsrichter, an der ein oder anderen Stelle eine Entscheidung zu erklären – nicht im laufenden Spiel, da wollen wir uns konzentrieren, aber ein kurzer Hinweis in passender Situation hilft. So kann ein Trainer das Verhalten ggf. korrigieren – nicht einmal unbedingt das Verhalten von sich, sondern auch von seinen Spielern, damit dasselbe Fehlverhalten nicht noch einmal gepfiffen werden muss.
Wo ist die Grenze im Umgang miteinander – gerade, wenn man im Landesverband eventuell seit Jahren kennt?
Wir werden niemandem verbieten können, sich zur Begrüßung zu umarmen, aber ich rate nicht dazu (lacht). Wenn die andere Seite das sieht, macht es immer einen schlechten Eindruck; da müssen sich beide Seiten über ihre Rolle bewusst sein. Das Gespräch mit dem Trainer vor dem Spiel ist und bleibt ein Smalltalk und während des Spiels gibt es maximal kurze Hinweise. Es ist unter dem Gesichtspunkt der Voreingenommenheit fatal, wenn man sich zu intensiv austauscht. Nach dem Spiel kann man sich dann, wenn Bedarf besteht, auch intensiver unterhalten. Der Austausch in der Kabine ist sehr wertvoll, das ist eine gut investierte Zeit, weil besser versteht, warum eine Entscheidung so getroffen wurde.
Das klingt alles sehr … vorsichtig.
Ich halte das in gewisser Weise auch für einen Eigenschutz. Ich habe selbst lange gepfiffen und irgendwann in den Hallen viele Menschen gekannt. Mir war es aber für meinen eigenen Schutz und für meine Rolle richtig zu zeigen. Ich bin heute als derjenige hier, der unparteiisch ist. Das ist meine Aufgabe, für die ich angesetzt bin. Ein Gespräch kann jedoch auch ein geschicktes Mittel sein, mit dem der Trainer versucht, einen Schiedsrichter so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen; da müssen wir als Schiedsrichter drauf achten.
Was sind im Spiel die Grenzen der Schiedsrichter?
Das ist natürlich ein Stückweit individuell, aber es gibt aber ein paar allgemein gültige rote Linien wie Beleidigungen beispielsweise. Es muss auch jedem Trainer klar sein, dass mit abfälligen Gesten eine Grenze überschritten wird – damit zeige ich ja ebenso öffentlichkeitswirksam wie despektierlich, dass ich mit dem, was der Schiedsrichter tut, nicht einverstanden bin. Das ist ein Punkt, den wir von der Bundesliga angefangen bis in die Landesverbände hinein nicht wollen und den im Umkehrschluss auch Trainer im Umgang mit sich nicht wollen: Ein arroganter, herablassender, einfach schlechter Umgang. Wenn der Schiedsrichter so handelt, ist das Geschrei groß. Daher muss es beidseitig die Aufgabe sein, für einen respektvollen Umgang zu werben. Es gehören Emotionen dazu, das macht unseren Sport aus, aber der respektvolle Umgang ist genauso ein Teil unseres Sports. Kritik kann ich als Trainer nach dem Spiel äußern, wenn die Emotionen abgekühlt sind. Das ist als Anstoß auch sehr viel sinnvoller für die Weiterentwicklung der Schiedsrichter als es auf dem Feld zu eskalieren.
Warum ist das ein Punkt, der dir so am Herzen liegt?
Gesten sind immer das, was alle sehen. Das muss klar sein. In einem Gespräch kann man auch mal den falschen Ton treffen, das wird sich nicht verhindern lassen, aber in dem Moment, wo ich außenwirksam Gesten setze oder den Schiedsrichter anschreie, bringt es mir definitiv keinen Nutzen. Als Trainer will ich damit keine Kommunikation mehr betreiben, sondern Wut rauslassen. Ich bin daher ein Freund des gesprochenen Wortes, das kann im Gegensatz zu Gesten und Geschrei helfen.
Was wäre abgesehen von der respektvollen Umgangsform ein Ratschlag an Schiedsrichter, wie sie zu einem guten Miteinander beitragen können?
Sich bewusst zu sein, welche Reaktion in welcher Situation angemessen ist. Da spricht man auch gerne von dem berühmten Fingerspitzengefühl. Der Gegenüber nimmt Dinge immer sehr unterschiedlich wahr und deswegen sollte man überlegen: Was hilft an dieser Stelle jetzt? Manchmal bedarf es einen strengen Blickes, manchmal kann aber auch geschickt eingesetztes Lächeln im richtigen Moment eher zur Deeskalation beitragen.
Was ist deine Einschätzung: Wie ist die Entwicklung im Verhältnis von Trainern und Schiedsrichtern in den vergangenen Jahren gewesen?
Das kann ich so pauschal nicht beantworten, weil sehr unterschiedlich mit dem Schiedsrichterwesen bzw. unseren Schiedsrichtern agiert wird. Das zeigt sich in der 3. Liga alleine an den Rückmeldungen, die wir aus den Vereinen bekommen: Einige geben sich unheimlich viel Mühe und das hilft den Schiedsrichtern zu reflektieren, wie ihre Leistung und ihre Entscheidungen bei den Vereinen ankommt. Andere beschränken ihre Rückmeldung auf das Minimum, sie nutzen die Möglichkeit des Dialogs nicht aus – und dann gibt es Vereine, deren Rückmeldungen überhaupt nicht helfen, weil sie an der Sache total vorbei gehen. Das ist schade, denn um die Brücke zum Anfang zu schlagen: Wir sitzen am Ende des Tages alle in einem Boot. Wir kämpfen alle um einen attraktiven Handball und dafür müssen wir uns gut miteinander reflektieren, damit beide Seiten davon lernen können und wir uns weiterentwickeln.
Das war jetzt eine sehr sachliche Antwort. Wie ist das auf der emotionalen bzw. persönlichen Ebene? Auf Social Media gibt es immer wieder Kommentare unter der Gürtellinie, auch von den Zuschauern müssen sich Schiedsrichter oft unsachliche Kommentare anhören. Wie ist das im Umgang mit den Trainern?
Das ist immer abhängig von den handelnden Personen und ihrer Interaktion miteinander. Das war vor zehn Jahren schon so und das wird auch in zehn Jahren noch der Fall sein. Ich werbe gerne dafür, gemeinschaftlich zu agieren – und das beidseitig. Als Schiedsrichter muss ich natürlich regeltechnisch Entscheidungen treffen, aber abseits des Spielfeldes die Interessen und Meinungen von Mannschaften und Vereinen respektieren.
Sprich: Es ist die Eigenverantwortung von jedem Schiedsrichter und jedem Trainer selbst, dass man „sein“ gemeinsames Spiel möglichst gut zustande bekommt?
Ich hoffe, dass genau das der Anspruch ist – egal, ob man als Trainer oder Schiedsrichter. aktiv ist. Wenn ich für die 3. Liga sprechen darf: Die 3. Liga ist in den letzten zehn Jahren so stark gewachsen wie noch nie und der Druck hat zugenommen, weil sich die wirtschaftlichen Verhältnisse extrem weiterentwickelt haben. Das spürt man auf den Bänken und darauf müssen unsere Schiedsrichter vorbereitet sein. Das passt zu dem Leitspruch, den ich seit meiner aktiven Karriere verfolge: In jedes Spiel vorbereitet, aber nie voreingenommen reingehen.
Viele Schiedsrichter an der Basis sind parallel als Spieler oder Trainer unterwegs bzw. Spieler und Trainer sind in den Landesverbänden parallel Schiedsrichter. Inwiefern hilft es, mitunter die andere Perspektive einzunehmen bzw. beide Seiten zu kennen?
Das hilft total, weil es das eigene Verständnis für die andere „Seite“ schärft. Wir haben als Schiedsrichter den regeltechnischen Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber die Herausforderungen als Trainer zu kennen, ist total wertvoll. Ich kann mich nur wiederholen: Wir sitzen in einem Boot und das muss jedem klar sein!